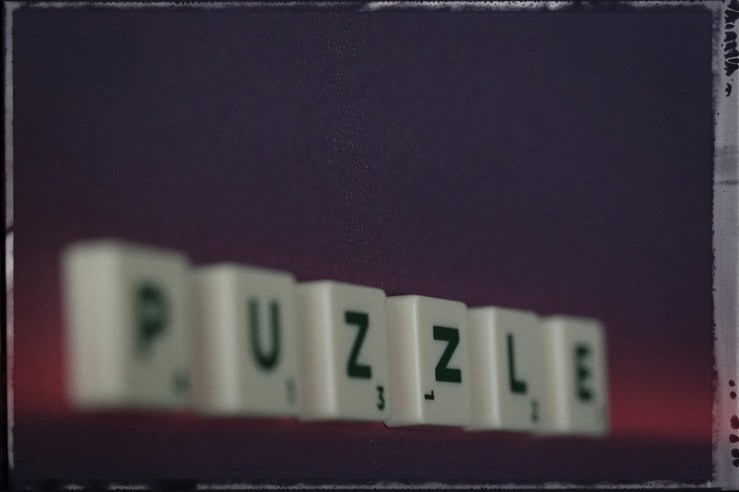„Hast du geschlitzt?“ Ja, genau so sagt er das. Geschlitzt.
Von vorn. Mein Papa ruft an. Seit Wochen habe ich nicht mehr mit ihm gesprochen, weil es mir bis Ostern so scheiße ging, dass ich nicht telefonieren konnte wollte. Das schrieb ich ihm vor einiger Zeit, und wünschte ihm einen schönen Urlaub. Ob ich in Behandlung sei, fragte er. Nein. Viel mehr schrieb weder ich noch er.
Nun also das unausweichliche Telefonat. Zuerst spricht er mit Schatz, während ich zunehmend nervöser werde. Über Gefühle mit Papa reden war noch nie meine Stärke.
Dann schwebt der Hörer vor meinem Gesicht, und ich nehme ihn mit einem inneren Seufzen entgegen.
Ob es mir besser geht, fragt er. Ja, nein, vielleicht, ein bisschen schon, denke ich – es ist kompliziert. „Ja, schon“, ringe ich mir ab, um Worte verlegen. Dann:“Hast du geschlitzt?“ Einen Moment lang kann ich nicht fassen, dass er überhaupt fragt, während ich die Wortwahl gleichzeitig faszinierend und abstoßend finde. Schon, ein bißchen, aber nicht annähernd genug schlimm. „Nein“ sage ich, bevor ich einen Gedanken daran verschwenden kann, ihm die Wahrheit zu sagen.
„Und du hast es auch nicht vor?“ fragt er dann, und im Tonfall schwingt neben Sorge auch Du dummes kleines Mädchen, wenn du es tätest mit. „Nee“ nuschle ich. Doch, und jetzt gerade ganz besonders, weil du mit so einer Frage und so einem Tonfall daherkommst, dass ich dir mir an die Kehle springen und dich anschreien will, dass das so einfach nicht ist, wie dein verbales, belächelndes Kopfschütteln es impliziert. „Ja, dann ist ja gut. Deswegen hatte ich auch gefragt wegen ärztlicher Betreuung und so, man macht sich ja Sorgen… Euer Urlaub war auch schön, habe ich gehört?“ wechselt er das Thema, während ich wieder daran hängen bleibe, dass meine körperliche Unversehrtheit wohl immer das Wichtigste bei Anderen zu sein scheint. Wenn nach Außen alles okay ist, kann es Innen schließlich auch nicht so schlimm sein. So viel zu der Frage von vor einigen Tagen, warum der Satz Stell dich nicht so an! so ausdauernd in meinem Kopf klebt.
Ja, es geht mir besser als vor Ostern. Vielleicht sogar ganz okay. Aber nach dem Telefonat ist da ganz viel Durcheinander. Alkohol half ein bisschen, und wenn ich nicht so Angst vor den Kalorien hätte, würde ich mich jetzt wohl ordentlich betrinken.